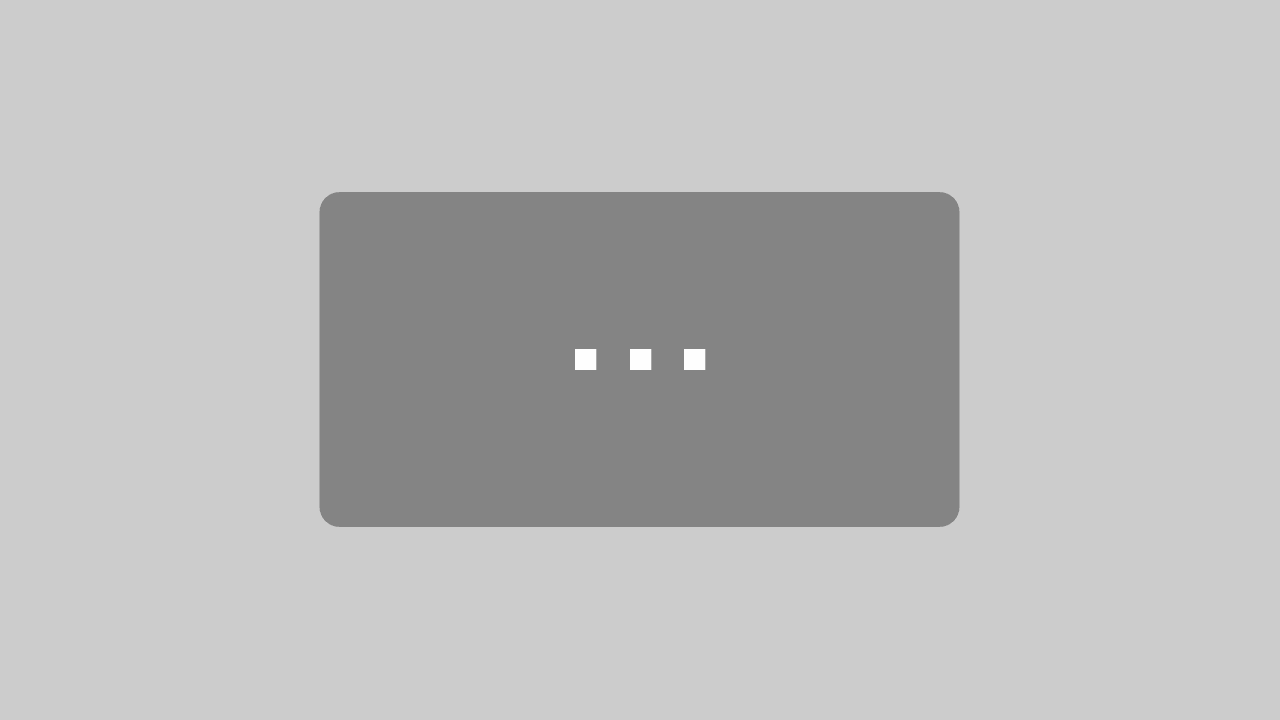Katastrophale Szenarien spielen sich ab – zum Glück nur simuliert. Beim TECC-Training der Airborne Medical Group zeigt Marc Zierden, wie Einsätze in Extremsituationen ablaufen.
Es ist dunkel, es ist eng und vor allem ist es laut. „Ahh, mein Bein! Ich blute, helfen Sie mir!“ Zwei Autos sind ineinander gerast, sechs Verletzte schreien oder sind bewusstlos. „Helfen Sie mir doch, ich verblute!“ Ein Ersthelfer kniet über einer Frau, die nicht mehr ansprechbar ist, während ein Mann in einer anderen Ecke schreit. „Jetzt helfen Sie mir doch!“ Kurz blickt der Ersthelfer auf, die Situation ist unübersichtlich, eng. Er kann nicht weg von der Frau, die ebenfalls stark blutet, um der anderen Person zu helfen.
Was wie ein Horrorszenario klingt, ist zum Glück nur eine Simulation. Sowohl die Unfallopfer als auch die Ersthelfer sind Teilnehmer eines sogenannten TECC-Kurses. TECC steht für Tactical Emergency Casualty Care und bedeutet so viel wie: Taktische Notfallversorgung. Das Ziel: In unübersichtlichen Lagen mit zahlreichen Verletzten die Ruhe bewahren, den Überblick behalten, strukturiert vorgehen und so Menschenleben retten.
Von Spezialisten für Jedermann
„Einem Menschen zu helfen ist so ein geiles Gefühl.“ Marc Zierden steht vor den zehn Teilnehmern des Kurses. Theorie ist angesagt. Wann ist es überhaupt sicher, jemandem zu helfen? Wann muss ich zusehen, dass ich mich nicht selbst in Gefahr bringe? Die Teilnehmer hören dem Instructor gebannt zu. Unter ihnen sind Rettungssanitäter, Polizisten, aber auch Zivilisten, die sich für die erweiterte Erste Hilfe interessieren. Sie sitzen in einem Medic-Zelt der US Army, das in dem großen Schulungsgebäude aufgestellt ist. Vor 16 Jahren war dort noch eine Hähnchen-Schlachterei untergebracht. Heute gibt es in den Hallen einen Übungsbereich, den Schulungsraum, ein urbanes Trainingsgelände. „Wir haben das alles selbst ausgebaut“, erzählt Marc. Die Halle gehört der Airborne Medical Group (AirMeG) und der Operative Fähigkeiten. Das Team besteht aus Spezialisten, einige sind aktiv im Militär oder Polizeidienst und wollen daher nicht erkannt werden.
Die TECC-Kurse der AirMeG sind bis ins kommende Jahr ausgebucht. Die Gruppen sollen klein bleiben. „So können wir individuell auf jeden Einzelnen eingehen. Wir sehen, wer was macht“, erklärt Marc. Oft werden die Teilnehmer nochmals aufgeteilt in eine Vierer- und eine Sechser-Gruppe, die dann jeweils zwei bis drei Instructor zur Seite gestellt bekommen. Auf diese Weise bleibt kein Fehler verborgen, und das ist wichtig. Fehler können im Training begangen werden, aber nicht in der Realität.

Im Zweifel bleiben nur Sekunden
Für die Teilnehmer steht ein straffes Programm an. Nach dem täglichen Sport- und Theorieteil geht es an die sogenannten Skill Stations. An Simulatoren oder den Teampartnern erlernen und üben die Frauen und Männer einzelne Fähigkeiten wie das Anlegen des Tourniquets, das Anbringen eines Druckverbands an der Leiste oder der Achsel, das Woundpacking, Punktieren und Intubieren. Natürlich werden auch Basics wie die stabile Seitenlage oder die Herzdruckmassage bei der Reanimation vertieft. Wie verwendet man beispielsweise einen Defibrillator und worauf muss man bei Kleinkindern und Babys achten?
Die Instructor wollen, dass ihre Schützlinge mehr mitnehmen als die reinen Skills. „Achselverbände sind ähnlich wie Halsverbände, für den Patienten oft sehr unangenehm. Erklärt den Leuten, was ihr macht, beruhigt die ein bisschen.“ Auf den Kontakt mit den Verletzten, aber auch mit den Menschen drum herum wird viel Wert gelegt. „Situational Awareness“ ist das Stichwort. Besteht beispielsweise bei einem Unfall die Gefahr, dass ein weiteres Auto in die Unfallszene fährt? Ist ein möglicher Täter nach einem Messerangriff noch in der Umgebung? Hin und wieder setzen sich die Instructor eine rote Stirnlampe auf und positionieren sich im Raum. „Täter!“, ruft auf einmal einer der Teilnehmer, der das rote Licht entdeckt hat. Je schneller, desto besser.

Das gilt auch für das Anlegen des Tourniquets. Immer wieder kommt zwischendurch die Ansage: „Tourniquet, linkes Bein.“ Dann haben die Teilnehmer nur noch Sekunden, um eine imaginäre, starke Blutung am eigenen Leib abzubinden. „Das muss schnell gehen, ihr habt im Zweifel nicht lange Zeit, bis ihr das Bewusstsein verliert.“ Auch wenn sowohl die Instructor als auch die Teilnehmer immer gut drauf sind und sich gegenseitig auf den Arm nehmen, wird immer wieder klar: Es geht um ernste Situationen, im schlimmsten Fall um Leben oder Tod. In der Theorie und am Simulator sind die Teilnehmer schon gut gerüstet. Doch sobald Druck hinzukommt, merken einige, wie schnell man unsicher wird und ins Straucheln kommt.
Einsatz in Extremsituationen
Und der Druck kommt spätestens am letzten Tag, in den Szenarien, die Marc und sein Team für die Teilnehmer vorbereitet haben. Schon zum Einstieg in den Kurs gab es einen simulierten Autounfall, um zu sehen, welche Fähigkeiten die Teilnehmer haben. Im Vergleich dazu will der Instructor eine deutliche Steigerung sehen. Während die eine Hälfte der Teilnehmer mit blutigen, aufgeschminkten Wunden in zwei Autos sitzt, müssen die übrigen Teilnehmer helfen. In dem engen Raum bricht schlagartig die Hölle los, es ist laut, es wird geschrien, aus einem Autoradio läuft laute Musik. Sowohl die Ersthelfer, aber auch die simulierten Opfer geben alles. Auf einmal bleibt jemandem der Atem stehen. Jemand anders wird aggressiv gegenüber den Rettern. „Wissen Sie überhaupt, was Sie da tun?“, wird herausfordernd gefragt.
Das zweite Szenario wird anspruchsvoller, ein häuslicher Angriff mit einem Messer. In beiden Fällen ist die besonders gemeine Herausforderung: Es gibt mehr Opfer als Helfer. Wer braucht also am meisten Hilfe? Wer kann vielleicht noch selbstständig gehen und sich in Sicherheit bringen? Diese Entscheidungen müssen wieder unter Geschrei und in Sekundenschnelle getroffen werden. Nach den beiden Szenarien besprechen sich die Teilnehmer untereinander. Zufrieden sind sie nicht, einiges lief nicht wie geplant und es war unklar, wer nun die Führung in der Notlage übernimmt. „Jeder macht Fehler“, sagt Marc. „Aber aus den Fehlern, die man gemacht hat, lernt man.“ Viel Zeit sich zu sammeln, haben die Teilnehmer nach dem Feedback nicht, denn es geht Schlag auf Schlag weiter mit dem abschließenden Szenario.

Dieses Mal ist Marc Teil der Helfer, um hier und da zu unterstützen. Sein restliches Team übernimmt die Rollen der Opfer und Polizisten. Die Lage: Eine Schießerei in einem Gebäude. Aufgrund der Gefahrenlage müssen sich erst alle in Sicherheit bringen. Als die Situation geklärt ist, beginnt die Arbeit. Die Verletzten schreien, manche keuchen nur. Niemand weiß so richtig, was passiert ist. Tiefe Wunden müssen versorgt werden, teilweise an schwierigen Stellen wie dem Oberkörper. Die Verwundeten dürfen im Schock nicht unterkühlen und müssen schnell transportbereit sein. Das Szenario verlangt den Kursteilnehmern noch einmal alles ab. Erst als der Rettungsdienst eintrifft, ist die Simulation beendet.

Exkurs: K9 – Hilfe für Vierbeiner
Der Hund ist der beste Freund des Menschen. Und besonders Diensthunde, ob bei Polizei oder Militär, werden von ihren Hundeführern geschätzt wie Kameraden. Umso wichtiger ist es, auch einen Hund erstversorgen zu können. Denn vieles funktioniert nicht so, wie es beim Menschen geht.
Dafür gibt es Eddy. Der dunkelbraune Hund ist nicht echt, sondern ein Simulator, mit Puls, einer blutenden Wunde und einem eingebauten Lautsprecher, über den er bellen kann. An Eddie zeigt Marc den Teilnehmern, wie sie bei einem verletzten Hund vorgehen müssen. „Als allererstes, bevor ihr irgendwas anderes macht, müsst ihr einen Beißschutz anlegen.“ Das kann ein Maulkorb sein, aber auch eine Bandage oder ein Verband, der um das Maul fixiert wird. „Du kannst dich nicht neben einen Diensthund knien, der verletzt ist. Der hat keine Freund-Feind-Kennung mehr“, erklärt Marc.
Weiter geht es mit der Behandlung von Wunden, Blutungen oder Atemnot. Nicht alles, was bei Menschen funktioniert, kann auch beim Hund angewendet werden. Diese Erkenntnis trifft einige Hundeführer hart. Marc erzählt von einer Simulation, die er mit Einsatzkräften durchgeführt hat. „Da standen Polizisten und hatten Tränen in den Augen, weil sie dann wussten, was sie nicht wissen.“ Dem eigenen Hund im Notfall nicht helfen zu können, weil das grundlegende Wissen fehlt, ist wohl für jeden Hundebesitzer ein Alptraum.